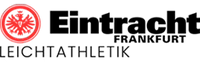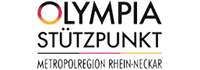Inhalt
Plagen Dich Rückenschmerzen im unteren Rücken? Dann fragst Du Dich vielleicht, was die Ursache dafür ist und wie Du endlich Klarheit bekommst. Eine präzise fachliche Diagnose ist der erste Schritt zur effektiven Behandlung des LWS-Syndroms. In diesem Beitrag erfährst Du, welche Diagnoseverfahren es gibt, wie sie ablaufen und welche Rolle jede Methode spielt – von der körperlichen und neurologischen Untersuchung bis zu bildgebenden Verfahren wie Röntgen, MRT und CT.
Was ist das LWS-Syndrom überhaupt?
Bevor wir tiefer in die Diagnoseverfahren einsteigen, lohnt sich ein kurzer Blick auf den Begriff selbst: Das LWS-Syndrom beschreibt Beschwerden im Bereich der Lendenwirbelsäule (LWS) – häufig verbunden mit Bewegungseinschränkungen, Muskelverspannungen oder ausstrahlenden Schmerzen. Es handelt sich dabei nicht um eine konkrete Erkrankung, sondern um ein Beschwerdebild mit vielfältigen Ursachen, wie z. B. Bandscheibenvorfälle, Verschleißerscheinungen (Degeneration), muskuläre Dysbalancen oder eine Spinalkanalstenose.
Der erste Schritt: Die körperliche Untersuchung
Ganz am Anfang jeder Diagnostik steht die körperliche Untersuchung. Diese ist essentiell, um erste Hinweise auf die Art und Lokalisation der Beschwerden zu erhalten. Sie ermöglicht eine erste Eingrenzung der Problematik, insbesondere in Bezug auf muskuläre oder funktionelle Ursachen. Sie ist der Ausgangspunkt für die Auswahl weiterer Diagnoseverfahren.
Folgendes wird in der Regel überprüft:
-
Körperhaltung und Gangbild
-
Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule
-
Schmerzreaktionen bei bestimmten Bewegungen oder Druck
-
Muskeltonus und Verspannungen
Ergänzend wichtig: Die neurologische Untersuchung
Wenn Verdacht auf eine Beteiligung von Nervenstrukturen besteht (etwa beispielsweise bei ausstrahlenden Schmerzen, Taubheitsgefühlen oder Kribbeln), kommt die neurologische Untersuchung ins Spiel. Diese umfasst:
-
Überprüfung der Reflexe
-
Testung der Sensibilität
-
Prüfung der Muskelkraft bestimmter Muskelgruppen
-
Koordinationstests
Solche Tests geben wichtige Hinweise darauf, ob z. B. ein Bandscheibenvorfall auf eine Nervenwurzel drückt. Je präziser die Symptome eingeordnet werden, desto gezielter kann später die Bildgebung erfolgen.
Die Bildgebung: Wenn’s ganz genau sein muss
Oft reichen körperliche und neurologische Untersuchungen nicht aus, um die Ursache der Beschwerden eindeutig zu klären. Dann kommen bildgebende Verfahren ins Spiel.
Röntgen
Ein Röntgenbild der Lendenwirbelsäule zeigt vor allem die knöchernen Strukturen – also Wirbelkörper, Stellung der Wirbel zueinander, mögliche Frakturen oder grobe Verschleißveränderungen (z. B. Arthrose). Was Du wissen solltest:
-
Kein Weichteilgewebe sichtbar (z. B. Bandscheiben oder Nerven)
-
Geringe Strahlenbelastung
-
Schnell durchführbar
Einsatzgebiet: Zur Beurteilung der Statik der Wirbelsäule, zur Frakturdiagnostik oder zur Feststellung degenerativer Veränderungen.
MRT (Magnetresonanztomographie)
Das MRT ist das wichtigste bildgebende Verfahren, wenn es um Weichteilstrukturen wie Bandscheiben, Nerven oder Rückenmark geht. Die Vorteile:
-
Keine Strahlenbelastung
-
Sehr detailreiche Darstellung
-
Geeignet bei Verdacht auf Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalstenose oder Nervenkompressionen
Ein MRT wird oft dann durchgeführt, wenn Beschwerden länger anhalten oder sich neurologische Ausfallerscheinungen zeigen. Auch zur OP-Planung werden die Informationen aus dem MRT genutzt.
CT (Computertomographie)
Die CT-Untersuchung nutzt Röntgenstrahlen und erstellt dreidimensionale Querschnittsbilder. Sie liefert eine genaue Darstellung der knöchernen Strukturen und wird häufig eingesetzt, wenn das MRT nicht verfügbar oder nicht durchführbar ist. CT kommt zum Einsatz bei:
-
Komplexen Wirbelverletzungen
-
Degenerativen Veränderungen, die im MRT unklar sind
-
Diagnostik bei Patienten mit Implantaten (z. B. Herzschrittmacher), bei denen kein MRT möglich ist
Wie läuft die Diagnostik in der Praxis ab?
Hier ein typischer Ablauf bei Verdacht auf ein LWS-Syndrom:
-
Anamnese: Ausführliches Gespräch über Beschwerden, Dauer, Intensität, Begleitsymptome
-
Körperliche Untersuchung: Beweglichkeit, Schmerzlokalisation, Muskelverspannungen
-
Neurologische Tests: Bei Verdacht auf Nervenirritationen
-
Bildgebung: Röntgen, MRT oder CT je nach Befundlage
Die Untersuchung kann variieren und je nach Ergebnis können weitere Tests notwendig sein (z. B. Labordiagnostik oder spezielle Funktionsprüfungen).
Was Du vor der Diagnose wissen solltest
-
Je genauer Du Deine Symptome beschreibst, desto besser können Ärztinnen und Ärzte den Untersuchungsfokus setzen.
-
Falls vorhanden: Bringe Vorbefunde mit, wie alte MRTs, Röntgenbilder oder Entlassungsberichte können helfen.
-
Habe keine Scheu vor bildgebenden Verfahren, befolge einfach die Anweisungen der Fachperson.
Bis zu Deinem Arzttermin kannst du selbst aktiv werden
Natürlich ersetzen diese Maßnahmen keine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Sie können jedoch helfen, die Zeit bis zu Deinem Arzttermin zu nutzen und Beschwerden etwas zu lindern:
- Leichte Bewegung wie Spaziergänge oder gezielte Rückenübungen stärken die Muskulatur und können helfen die Durchblutung zu fördern.
- Wärmeanwendungen entspannen verspannte Muskeln, bei akuten Entzündungen solltest du jedoch kühlen.
- Achte im Alltag auf ergonomisches Heben sowie Sitzen und nutze Hilfsmittel wie eine Massagepistole oder Akupressurmatte (Hinweis: Nicht bei offenen Wunden, empfindlicher Haut oder direkt auf der Wirbelsäule anwenden).
Was macht die OrthoGun 3.0 so besonders?
Die OrthoGun 3.0 bietet 5 Intensitätsstufen für eine tiefenwirksame Muskelbehandlung. Im Frequenzbereich von 19 bis 53 Hz entfaltet sie schon ab 19 Hz eine wohltuend entspannende Wirkung und bleibt selbst auf höchster Stufe laufruhig. Dank der wechselbaren Aufsätze ist sie an individuelle Bedürfnisse anpassbar. Der langlebige Akku mit bis zu 6 Stunden Laufzeit und ihr Leichtgewicht von 770g machen sie zum perfekten Begleiter im Alltag oder beim Sport. Sichere Dir jetzt den App Zugang mit Expertenvideos zur Anwendung!
Was macht die OrthoMatte so besonders?
Ob nach einem langen Tag oder intensiver körperlicher Aktivität: Die OrthoMatte ist die erste Akupressurmatte mit Vibrationsfunktion, die klassische Akupressur mit sanften, beruhigenden Schwingungen kombiniert. Diese Kombination kann helfen, Verspannungen zu lösen, die Durchblutung zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Die Wirkung ist dabei natürlich individuell. Unsere Expertin für ganzheitliche Gesundheit Lisa-Marie Thiele empfindet die Vibration als Sinnbild für das “Om” im Yoga, das Körper und Geist in Einklang bringt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
-
Wie lange dauert ein MRT der LWS?
In der Regel etwa 20–30 Minuten. Die Untersuchung ist schmerzfrei, Du musst aber stillliegen. -
Ist eine Röntgenaufnahme der LWS gefährlich?
Die Strahlenbelastung ist gering und wird nur dann eingesetzt, wenn medizinisch notwendig. -
Was kostet eine LWS-Diagnostik?
Für gesetzlich Versicherte sind die Kosten in der Regel durch die Versicherung abgedeckt, wenn die Untersuchung ärztlich verordnet ist. Bei privaten Versicherungen oder Selbstzahlern hängen die Kosten vom Verfahren ab. -
Warum werden manchmal MRT und CT kombiniert?
Bei unklaren Befunden oder zur Operationsplanung kann die Kombination beider Verfahren zusätzliche Informationen liefern.
Fazit
Klarheit schafft mehr Sicherheit: Eine präzise Diagnose ist das Fundament jeder erfolgreichen Behandlung beim LWS-Syndrom. Dabei ist es entscheidend, dass körperliche, neurologische und bildgebende Verfahren sinnvoll miteinander kombiniert werden. Nur so lässt sich die tatsächliche Ursache Deiner Beschwerden finden. Warte also nicht zu lange mit dem Gang zum Arzt. Je früher eine Diagnose gestellt wird, desto besser lässt sich oft behandeln und Du gewinnst Deine Lebensqualität zurück.